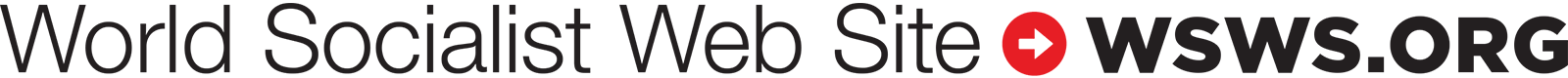Jede Dekade wiederholt sich das groteske Spektakel, mit dem die SPD ihre runden Geburtstage zu feiern pflegt. Gestern war es der einhundertvierzigste. Keine andere Partei legt so viel Betonung auf ihre Geschichte und Tradition - und ist gleichzeitig völlig desinteressiert an geschichtlichen Lehren und historischer Wahrheit.
Schon der Blick auf die Eintrittskarte zur diesjährigen Festveranstaltung ruft einen Stoßseufzer hervor. Die abgebildete Ahnenreihe beginnt mit dem Konterfei von August Bebel und endet bei Gerhard Schröder - dazwischen: Rosa Luxemburg, Kurt Schumacher und Willy Brandt. Was für ein Niedergang! Man möchte ausrufen: "Hände weg von Bebel und Luxemburg - den großen Sozialisten!"
Auffallend an den gegenwärtigen Feierlichkeiten ist, dass niemandem zum Feiern zumute ist. Seit Monaten wird die Partei von ihrem Vorsitzenden erpresst, ein Kürzungsprogramm in allen Sozialbereichen zu unterstützen, das alles auf den Kopf stellt, was die SPD in früheren Zeiten vertreten hat. Die gesetzlichen Sozialversicherungen, die fast so alt sind wie die SPD selbst und vom ersten Reichskanzler Otto von Bismarck eingeführt wurden, um der jungen SPD das Wasser abzugraben, werden nun von einer sozialdemokratischen Regierung abgeschafft. Welche Ironie der Geschichte.
Vor 130 Jahren konnte Bismarck weder mit Zuckerbrot noch mit Peitsche in Form von Sozialistengesetz und Sozialreformen den Aufstieg der SPD verhindern. Nun schafft ein sozialdemokratischer Kanzler Schritt für Schritt die gesetzlichen Sozialversicherungen ab und leitet damit das Endstadium einer langen politischen Degeneration der eigenen Partei ein.
Als ein Dutzend Parlamentsabgeordnete dagegen protestierten und durch das Sammeln von Unterschriften eine Mitgliederbefragung anstrebten, reagierte der Parteivorstand empört. Fraktionschef Franz Müntefering, früher auch Generalsekretär der Partei, bezeichnete die Initiative als "riesengroße Sauerei" und drohte jedem Abgeordneten, "der dem Kanzler in den Rücken fällt", mit Konsequenzen. In der Partei, die in ihren Anfangsjahren Demokratie und Sozialismus auf ihre Fahnen geschrieben hatte, werden heute elementare demokratische Rechte unterdrückt und jeder "Abweichler" eingeschüchtert.
Unter dem Beifall der rechten Medien stellt Kanzler Schröder vor allen wichtigen Abstimmungen in Partei und Parlament die Vertrauensfrage oder droht mit Rücktritt. Viele Kommentatoren werten dies als Führungsstärke und applaudieren, doch das Gegenteil ist der Fall. Ein Parteiführer, der seine Autorität nur noch durch Ultimaten und Rücktrittdrohungen aufrecht erhalten kann, hat sie im Grunde bereits verloren. Unterwürfig und gesprächsbereit gegenüber Konzernen und Wirtschaftsverbänden hat Schröder innerhalb der Partei eine regelrechte Diktatur errichtet und macht jede Opposition mundtot.
In einer Festrede am Donnerstag Abend erklärte Parteichef Schröder feierlich, die Agenda 2010 stände in "bester sozialdemokratischer Tradition". Wohl wahr! Seit sich der Opportunismus vor knapp neunzig Jahren in dieser Partei durchsetzte, ist sie immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen und hat dabei den reaktionärsten gesellschaftlichen Kräften Vorschub geleistet.
Heute ist es wieder so. Die geplanten Sozialkürzungen und die Art und Weise, wie die sozialdemokratische Führung mit Partei und Parlament umspringt, stärken und ermutigen die Rechten in CDU/CSU und FDP. Die Situation erinnert an die zwanziger und dreißiger Jahre. Damals hat die Regierung des Sozialdemokraten Hermann Müller mit ihrer unsozialen Politik dem Zentrumspolitiker Heinrich Brüning den Weg geebnet, der dann mit Notverordnungen regierte und zum Steigbügelhalter der Hitler-Diktatur wurde. Schon damals war klar, dass sich die von der SPD eingeleitete Abschaffung und Einschränkung sozialer, demokratischer und parlamentarischer Rechte am Ende auch gegen die SPD selbst richtet.
Doch diese Partei hat längst verlernt, aus der Geschichte Lehren zu ziehen, oder die politischen Konsequenzen ihrer Angriffe auf soziale und demokratische Rechte zu bedenken. Das gilt auch für die parteiinterne Opposition. Sie kritisiert die Schröder-Führung, hat ihr aber nichts entgegen zu setzen. Oskar Lafontaine wirft der Parteiführung bei jeder Gelegenheit Wahlbetrug vor und weist darauf hin, dass diese Regierung eine schlimmere Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben betreibt, als alle Nachkriegsregierungen vor ihr. Aber was ist seine Antwort?
Als Parteivorsitzender, Architekt des Wahlsiegs von 1998 und Finanzminister hätte er die Möglichkeit gehabt, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Doch kaum geriet er unter den Druck der Wirtschaftsverbände, warf er das Handtuch und überließ Schröder das Feld. Nicht nur Schröder, von dem man weiß, dass er den Firmenchefs die Wünsche von den Lippen abliest, auch Lafontaine ist nicht bereit, der Wirtschaftslobby entgegenzutreten. Auch er will keine Mobilisierung von unten und keine gesellschaftlichen Konflikte. Weil aber die Offensive der Neoliberalen nicht ohne eine breite Mobilisierung der Bevölkerung gestoppt werden kann, zog er sich feige zurück.
Ähnlich wie Karl Kautsky vor hundert Jahren noch die Phraseologie der Revolution vertrat, als die Praxis der Partei längst den opportunistischen Theorien Eduard Bernsteins folgte, vertritt Lafontaine heute die Phraseologie des Sozialreformismus der siebziger Jahre, während sich die Partei längst auf einem wirtschaftsliberalen Kurs befindet. Wie damals bilden auch heute die gegensätzlichen Tendenzen nur den rechten und den linken Stiefel des Opportunismus. Allerdings ist auch der Reformismus in den vergangenen hundert Jahren gewaltig auf den Hund gekommen.
Niemand mehr erwartet von dieser Partei einen ernstzunehmenden Beitrag zu einer fortschrittlichen Lösung der großen gesellschaftlichen Probleme. Es herrscht Katzenjammer und Endzeitstimmung auf dieser Geburtstagsparty. Im vergangen Monat, dem April, traten nach Angaben des Parteivorstands 7283 Mitglieder aus der SPD aus - durchschnittlich 242 jeden Tag.
Das Hauptargument der völlig abgestumpften Parteibürokratie lautet: Wenn wir es nicht machen, dann tun es die Konservativen, und alles wird noch schlimmer. Angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Situation - national, wie international - bleibe kein anderer Weg als Sozialabbau für die Schwächsten und Steuervergünstigungen für die Stärksten und Reichsten.
Durch die Steuerreform vor drei Jahren wurden die Unternehmen in einem Umfang von 30 Milliarden Euro entlastet. Viele Großunternehmen zahlen nicht nur keinen Cent Steuern, sonder erhielten in den vergangen zwei Jahren Millionenbeträge von den Finanzämtern zurückerstattet. Selten zuvor hat sich eine Regierung derart offensichtlich und schamlos zum Büttel der Reichen gemacht - und immer mit dem Argument: Man kann nichts anderes machen.
Der Gegensatz zu den Gründerjahren der SPD könnte krasser nicht sein. Damals, im Kaiserreich, waren die gesellschaftlichen Verhältnisse weitaus schlechter, aber die Antwort der frühen Sozialdemokraten war der heutigen entgegengesetzt. Sie lautete: Es muss etwas getan werden! Gewaltiger Optimismus und die Überzeugung, dass die politische und kulturelle Bildung der Massen den Schlüssel zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft darstellt, inspirierten die politischen Initiativen des jungen August Bebel und anderer Sozialisten der ersten Stunde.
Als sich im Mai 1863 Delegierte aus elf Städten in Leipzig versammelten und in Gegenwart von etwa 600 Arbeitern den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gründeten, war der 23-jährige Bebel nur Zuhörer, genoss aber in den Arbeiterbildungsvereinen bereits großes Ansehen. Sechs Jahre später gründete er gemeinsam mit Wilhelm Liebknecht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei und trat der Ersten Internationale bei.
Das war der Beginn einer machtvollen Bewegung, die bald darauf die Herzen und Köpfe der Arbeiter in Stadt und Land eroberte. Gestützt auf die Lehren von Marx und Engels wurde die frühe Sozialdemokratie zum Inbegriff des Kampfs für Freiheit und Demokratie.
In den Reden von August Bebel nahm die Vision einer neuen, höherstehenden Gesellschaft konkrete Gestalt an. Nicht Ausbeutung und persönliche Bereicherung gepaart mit Dummheit und Arroganz sollten künftig den Ton angeben, sondern soziale Gleichheit, Solidarität und Bildung für alle. Trotz der Unterdrückung durch den preußischen Obrigkeitsstaat und die Bismarckschen Sozialistengesetze wuchs die Partei in rasantem Tempo.
Die Aufbruchstimmung in eine bessere Zukunft war um die Jahrhundertwende weit verbreitet und stützte sich auch auf die schnelle Entwicklung von Technik und Wissenschaft. Doch der machtvolle Aufstieg des Kapitalismus nährte auch eine schnell wachsende opportunistische Strömung, die schließlich den Großteil der Parteiführung erfasste. Nur ein Jahr nach dem Tod von Bebel stimmte die SPD-Reichstagsfraktion im August 1914 den Kriegskrediten des Kaisers zu und führte damit Millionen Arbeiter auf die Schlachtbank des Ersten Weltkriegs.
Dieser Verrat hatte verheerende Auswirkungen auf das ganze zwanzigste Jahrhundert. Von nun an setzte sich die SPD uneingeschränkt für die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Ordnung ein und sah ihre Aufgabe darin, jede revolutionäre Umwälzung zu unterdrücken. Als am Ende des Kriegs die Russische Revolution der sozialistischen Bewegung einen machtvollen Anstoß gab und in Deutschland der Kaiser gestürzt wurde, erschienen im SPD-Zentralorgan Vorwärts Werbeanzeigen für die konterrevolutionären Freikorps - aus denen später viele Nazi-Größen hervorgingen.
Während der SPD-Vorsitzende und spätere Reichspräsident Friedrich Ebert mit der Obersten Heeresleitung zusammenarbeitete, organisierte sein Parteifreund Gustav Noske als Leiter des Militärressorts die blutige Unterdrückung des Spartakus-Aufstands und ließ Tausende revolutionärer Arbeiter abschlachten. Die prominentesten Opfer waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Es folgte die Weigerung der SPD, gemeinsam mit den Kommunisten gegen Hitler und die Nationalsozialisten zu kämpfen. Nach der Machübernahme Hitlers boten die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer dem faschistischen Regime die Zusammenarbeit an, was sie allerdings nicht vor den Konzentrationslagern rettete. "Der verfaulteste Teil des faulenden kapitalistischen Europa ist die sozialdemokratische Bürokratie," schrieb Leo Trotzki 1932.
Aufgrund der Rolle des Stalinismus gelang es der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal, Einfluss zu gewinnen. Sie nutzte die Verbrechen der stalinistischen Bürokratie, um antikommunistische Stimmungen zu schüren. Und die wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg ließ die soziale Marktwirtschaft als erfolgreiche Alternative zum Sozialismus erscheinen.
Ihre größten Erfolge erzielte die SPD, kurz nachdem der Nachkriegsboom seinen Höhepunkt erreicht hatte - Anfang der siebziger Jahre. Seither geht es mit ihr bergab, und zwar in immer schnellerem Tempo. Das Ende des Kalten Kriegs hat auch das Endstadium der SPD eingeläutet. Es gibt keine Grundlage mehr für eine Politik des sozialen Ausgleichs und der Kompromisse. Die veränderte Rolle der USA, unter deren Schutz die Sozialdemokratie ihre Reformpolitik betreiben konnte, hat ihr den Boden entzogen.
Kein Zweifel - August Bebel hätte für die heutige SPD und all ihrer streitenden Fraktionen und Tendenzen nur Verachtung und Spott übrig. Der Fäulnisprozess ist weit fortgeschritten, seit Rosa Luxemburg diese Partei als "stinkenden Leichnam" bezeichnete.
Gegen diejenigen, die das 20. Jahrhundert als Grab aller sozialistischen Hoffnungen betrachten, würden Bebel und Luxemburg daran erinnern, dass auch die Geburt der bürgerlichen Gesellschaft schmerzhaft war und lange dauerte. Die großen Errungenschaften in Technik und Wissenschaft würden sie als Beweis für die enorme schöpferische Kraft der Menschen werten. Und statt über den Niedergang einer Partei zu jammern, die sich selbst überlebt hat, würden sie dazu aufrufen, das politische Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.