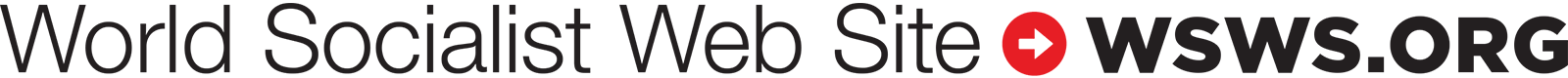Am 13. Dezember beschloss die rot-rot-grüne Regierung in Berlin, dass Flüchtlinge aus Massenunterkünften zügig in so genannte Tempohomes umziehen sollen. Dabei handelt es sich um Containersiedlungen, die vom bisherigen rot-schwarzen Senat in Auftrag gegeben wurden und zum Teil schon fertiggestellt sind.
Noch immer leben in Berlin über 20.000 Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen in Flughafenhangars, Turn- und Messehallen. Gerade erst traten Bewohner einer solchen Unterkunft in Berlin-Dahlem in den Hungerstreik, um auf die untragbaren Zustände aufmerksam zu machen.
Die Linke, die in der neuen Regierung die Senatorinnen für Wohnen und Bauen und für Arbeit, Integration und Soziales stellt, preist nun die temporären Containerbauten als Heilsbringer für die verzweifelten Flüchtlinge. Sie seien immer noch besser als die Turnhallen. Der Senatsbeschluss vom Dienstag sei ein „Signal für einen wirklichen Politikwechsel“, so die flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion Katina Schubert.
Schaut man die Tempohomes jedoch genauer an, wird schnell deutlich, dass hier kaum von menschenwürdigem und angemessenem Wohnraum zu sprechen ist.
Das im Herbst 2015 beschlossene Sonderbauprogramm war ursprünglich für dreißig, nach den gesunkenen Flüchtlingszahlen inzwischen für achtzehn Containerdörfer vorgesehen. Sie sind auf maximal drei Jahre ausgelegt und werden größtenteils an der Peripherie Berlins errichtet, weit entfernt von den Innenstadtbezirken mit ihrer Infrastruktur, ihrem U-Bahn-System, ihren Bildungs- und Kultureinrichtungen.
Sie liegen meistens neben oder in Gewerbegebieten sowie an großen Straßen und nicht selten auch an Bahngleisen. Ende 2014 wurde eine Ausnahmeregelung im Bauplanungsrecht in Kraft gesetzt, die Unterkünfte für Flüchtlinge an Orten erlauben, die eigentlich nicht für Wohnzwecke geeignet sind.
Ähnlich wie die gegenwärtigen Massenunterkünfte sollen externe Betreiber die Wohnanlagen organisieren und verwalten. Sie erhalten für drei Jahre einen garantierten Tagessatz pro Flüchtling und können damit ein lukratives Geschäft machen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich bei den europaweiten Ausschreibungen pro Standort ein regelrechter Run entwickelt. Die rund 30 bis 50 Unternehmen, die sich inzwischen um den Betrieb eines Containerdorfs bewerben, hätten gemerkt, „dass da durchaus ein ökonomisches Potenzial drinsteckt“, zitierte kürzlich die Online-Ausgabe der Welt den Sprecher des Berliner Landesamtes für Flüchtlinge (LAF) Sascha Langenberg.
Nach Angaben der Senatsverwaltung sollen pro Anlage rund 280 bis 500 Personen einquartiert werden, bei einem Doppelstandort bis zu 1000. Die Wohneinheiten bestehen aus je drei Containern mit jeweils ca. 13, zusammen also gerade mal 39 Quadratmetern. Hier sollen vier bis acht Personen zusammen wohnen – je nachdem, ob der Senat die Wohnanlage als „Notunterkunft“ mit hoher Belegung oder als „Gemeinschaftsunterkunft“ mit geringerer Belegung deklariert. Auf der Internetseite des Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF, vormals Lageso) wird unter „FAQ zu Tempohomes“ diese Flexibilität explizit als Vorteil gegenüber „Umbauten von bestehenden Immobilien“ ausgewiesen.
Die Inneneinrichtung der Unterkünfte ist dabei mehr als spartanisch: Die Fenster befinden sich in den beiden Wohncontainern an der kurzen Seite, im Küchencontainer wurde gleich ganz auf eines verzichtet. Bei einer Containerlänge von etwa sechs Metern ist somit der hintere Bereich des Raumes nur schwer zu belüften, geschweige denn von Tageslicht erhellt. Dadurch, dass die neuen Containersiedlungen anders als frühere nur ebenerdig angeordnet sind, sei „jede Wohneinheit individuell zugänglich“, lobt das LAF das Konzept auf seiner Website.
Doch schon die Anordnung der Containersiedlungen macht deutlich, wie wenig sie auf eine freie Wohn- und Lebensgestaltung ausgerichtet sind. Sie werden auf abgelegenen Brachflächen realisiert – ohne Begrünung oder Schatten spendende Bäume. Jedes Gelände wird umzäunt und erhält eine Eingangspforte mit Einlasskontrolle und Sicherheitspersonal. Versorgungsgebäude, Kinderspielzimmer, PC-Raum und Ähnliches befinden sie ebenfalls innerhalb dieser Umzäunung.
Auf diese Weise erhält die Tempohome-Siedlung Ghettocharakter. Abgeschnitten von der Nachbarschaft, mit zu „Wohngebäuden“ umfunktionierten Containern, die man sonst vor allem aus dem globalisierten Warenumschlag oder von Baustellen kennt, soll allen klar vor Augen geführt werden: Wer hier wohnt, ist Flüchtling, nur vorübergehend in Deutschland geduldet und Mensch zweiter oder dritter Klasse.
Es mutet schon grotesk an, wenn der Senat jetzt den jeweiligen Bezirken, in denen solche Containersiedlungen errichtet werden, 1 Million Euro für „Integrationsmaßnahmen“ zur Verfügung stellen will.
Dass es sich nicht nur um eine kurzfristige, vorübergehende Lösung handelt, sondern die langfristige Unterbringung in Sammelunterkünften zum neuen sozialen Standard werden soll, zeigt sich in den sogenannten „Modularen Unterkünften von Flüchtlingen (MUF)“, die im kommenden Jahr entstehen sollen und an denen auch der neue rot-rot-grüne Senat festhalten will.
Anders als die Container sind die MUF auf bis zu hundert Jahre ausgelegt. In einer Betonfertigbauweise, ähnlich früherer Plattenbauten, werden große, fünfgeschossige Heime hochgezogen, in denen es noch größere Probleme bei Belichtung und Belüftung geben wird. Abgesehen von den sanitären Gemeinschaftsanlagen bleiben auch viele Küchen und Wohnbereiche ohne Tageslicht. Die Menschen müssen weiterhin in Enge leben und haben kaum Privatsphäre. Zwei Personen sollen ein 16 Quadratmeter großes Zimmer bewohnen, 15 Personen sich zwei Duschen teilen.
Die Architekturzeitschrift Bauwelt spricht treffend von einer grundlegenden Verschiebung vom „Wohnen zur Unterbringung“. Die „Modularen Unterkünfte“ seien nur mit einem „außerordentlichen Aufwand in Einzelwohnungen umbaubar“, heißt es weiter.
Dies belegt die langfristige Perspektive des Senats, der nur für eine Minderheit der Geflüchteten Wohnung und Integration einplant. Schon jetzt sinkt von Jahr zu Jahr der Prozentsatz von Asylbewerbern, denen es gelingt, eine Privatwohnung zu bekommen. Nach den Zahlen von 2013 lag er bei 58 Prozent. Neuere Zahlen liegen nicht vor, aber es ist anzunehmen, dass der Prozentsatz seitdem auf ein Minimum gefallen ist.
Zugleich werden die sozialen Mindeststandards, die den Wohnungsbau der Nachkriegszeit prägten und die sich an das Programm des sozialen Wohnungsbaus in den 20er Jahren unter dem Motto „Licht, Luft, Sonne“ anlehnten, ausgehebelt. Als Erste müssen darunter geflüchtete Familien leiden, doch letztlich trifft dies auch andere Arbeiterfamilien, die sich die horrenden Mieten nicht mehr leisten können und in immer elendere Wohnquartiere abgedrängt werden.
Mit der Entscheidung für den Bezug der Tempohomes und den Weiterbau der MUF hat der rot-rot-grüne Senat deutlich gemacht, dass er die rechte Flüchtlingspolitik des alten SPD-CDU-Senats fortsetzen wird. Nur eine Woche nach Amtsantritt verabschiedet er sich von seinem Versprechen einer dezentralen Unterbringung in individuellen Wohnungen. Im Koalitionsvertrag hieß es noch, Rot-Rot-Grün wolle „geflüchtete Menschen zügig in Wohnungen unterbringen”. Davon ist jetzt keine Rede mehr.
Verantwortlich als Bausenatorin ist künftig die Linke Katrin Lompscher. Sie war ehemals Gesundheitssenatorin im rot-roten Senat von Klaus Wowereit, der Zehntausende Sozialwohnungen an Hedgefonds und die Deutsche Bank verkauft und die heutige Wohnungsnot hauptsächlich zu verantworten hat.
Jetzt muss der selbst geschaffene Wohnungsmangel als Begründung herhalten, um Flüchtlingsfamilien in Containerdörfer zu zwingen und auf lange Sicht in ghettoähnliche Siedlungen abzuschieben.