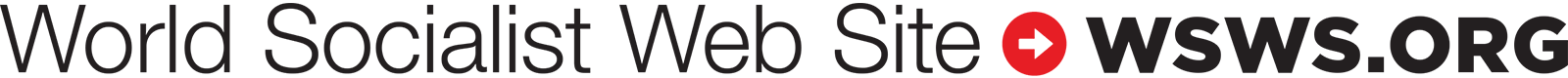In den kommenden Wochen laufen einige der diesjährigen Berlinale-Filme in Kinos an, nachdem die Corona-Beschränkungen weitgehend gelockert worden sind. Der Eröffnungsfilm des Berlinale Summer Special „Der Mauretanier“ ist bereits jetzt zu sehen.
Die WSWS-Redaktion will an dieser Stelle zwei Filme empfehlen, unabhängig vom Zeitpunkt des Kinostarts: „Azor“ von Andreas Fontana, der in diesem Jahr nur für die deutsch- und französischsprachige Schweiz angekündigt ist, sowie „Die Saat“ von Mia Maariel Meyer.
Beide Filme betrachten zwei Seiten derselben Medaille: „Azor“ beleuchtet das Leben der Banken- und Finanzaristokratie und ihre bedrohliche Nähe zur Diktatur. „Die Saat“ folgt dem Leben einer Arbeiterfamilie, die von derselben Bankenmacht und den von ihr geförderten Immobilienspekulanten bedroht wird.
„Azor“
Der Debütfilm „Azor“ des Schweizer Regisseurs Andreas Fontana, gezeigt in der neuen Sektion Encounters, blieb leider ohne Preis. Dabei befasst er sich mit einem hochaktuellen Thema und besticht zudem durch eine ausgezeichnete Dramaturgie und Darstellung.
Der Schweizer Privatbankier Yvan De Wiel (Fabrizio Rongione) fährt mit seiner Frau Inés (Stéphanie Cléau) nach Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, zur Zeit der Militärdiktatur Anfang der 80er Jahre. Er will den plötzlich verschwundenen Geschäftspartner René Keys finden, der bisher seine Bank in Argentinien vertreten hat, und zugleich die reichen Kunden beruhigen.
Der Zuschauer wird in die abgeschottete und abgehobene Finanzwelt geführt, sehr real und erschreckend brutal.
Als Yvan und Inés De Wiel im Taxi vom Flughafen zum Hotel gebracht werden, sehen sie, wie bewaffnete Milizionäre junge Leute an eine Wand stellen. Schüsse hört man nicht, auf Nachfragen von Inés fährt der Taxifahrer achselzuckend weiter. Es ist ein alltägliches Ereignis. Man schätzt, dass in der Zeit der Militärjunta von General Videla, die 1976 durch einen CIA-gestützten Putsch an die Macht kam, rund 30.000 Menschen ermordet wurden oder „verschwunden“ sind.
Fontanas Film legt den Fokus jedoch nicht auf die Opfer des Terrors, sondern auf die Perspektive der Nutznießer, Helfershelfer und Profiteure der Junta – Bankiers, Geschäftsleute, Militärs, Diplomaten, Großgrundbesitzer, Kirchenhäupter. Die folgende Szenerie spielt sich zwischen Luxushotels, Swimmingpools und Pferderennen ab. Die Wette auf die Rennpferde wird zum Symbol für das, was in Kreisen des Finanzkapitals stattfindet: Hauen und Stechen um den ersten Platz in der Welt des Profits, egal wieviel Tote und Verschwundene dies kostet.
Yvan De Wiel ist kultiviert und gebildet, mit Worten von Goethe auf den Lippen, dezent geschäftlich gekleidet und diskret. Er und seine Frau bewegen sich vorsichtig und zurückhaltend bei den exklusiven Empfängen, Gesprächsterminen, oder beim gemeinsamen Ausritt mit alteingesessenen Grundbesitzerfamilien, die ihr Leid klagen, dass auch sie unter den Repressionen der Junta leiden müssen.
Gemeinsame Sache mit der Junta traut man Yvan De Wiel auf den ersten Blick nicht zu. Als er jedoch in die wahre Zitadelle der Macht in Argentinien eingeführt wird, den Club „El círculo de armas“, wo die obersten Militärs mit Bankern, Geschäftsleuten und Diplomaten konspirieren, baut sich eine unheimliche Spannung auf. Im eleganten Club herrscht eine gedämpfte Atmosphäre, man stellt sich gegenseitig vor, Murmeln, höfliche Floskeln, leise Dialoge.
Man ahnt, worüber sie reden, über Investitionen, Transaktionen ins Ausland, Sparmaßnahmen und wie sie die Opposition in der Bevölkerung brechen können, oder, um mit den Worten des ebenfalls anwesenden katholischen Erzbischofs Tatoski zu sprechen, wie sie „die Parasiten von den Straßen säubern, selbst aus den besten Familien“.
Der Titel „Azor“ ist doppeldeutig: Im Spanischen ist Azor der Name des Raubvogels Habicht, der kleinere Vögel und Federvieh frisst; im Französischen ist es ein Code-Wort dafür, dass man „nicht zu viel sagen“, „seine Karten nicht offenlegen“ soll.
Als man Yvan im Club nach seinen ersten Eindrücken vom Land fragt, vergleicht er sich mit Hernán Cortés, der sich „auch ein bisschen orientierungslos gefühlt haben muss, als er von Bord ging“. Cortés war der Konquistador, der im 16. Jahrhundert im Auftrag der spanischen Monarchie den Eroberungsfeldzug gegen die Azteken anführte. Er sehe De Wiel und Keys als „Komplizen einer diskreten und gnadenlosen Form der Kolonisierung“, sagt der Regisseur dazu.
Monsignore Tatoski (Pablo Torre Nilson), der dem realen argentinischen Erzbischof jener Zeit, Adolfo Servando Tortolo, nachempfunden ist, leitet schließlich De Wiel in ein Nebenzimmer und befragt ihn mit lauerndem Blick nach den optimalen Anlagemöglichkeiten für das Kirchenvermögen. Er will wissen, ob De Wiel ebenso skrupellos agieren will wie sein Vorgänger René Keys, der mit hochriskanten Devisengeschäften spekuliert hat.
Auf die Frage nach dem Verbleib von Keys und dem Hinweis auf das Wort „Lázaro“, das Yvan in Keys‘ Terminkalender gefunden hat, blitzen Tatoskis Augen auf. Er wolle wohl genauso gut sein wie Keys, aber mit einem „anderen Stil“? Denn jener sei zu weit gegangen, er habe „uns als Mörder bezeichnet“.
Was es mit „Lázaro“ auf sich hat, erfährt man in der Schlussszene. De Wiel wird per Boot auf einem gewundenen Fluss durch den Dschungel zur Insel Lázaro gebracht, die als Militärzone ausgewiesen ist. Yvans Frau hat ihn vor der Fahrt bestärkt: „Du musst besser sein als Keys.“
„Lázaro“ entpuppt sich als schmutziger Deal zwischen dem Bankier und der Militärjunta. Milizkommandeure lesen ihm eine Liste von Wertgegenständen vor – Autos, Möbel, Gold, Silber, Kunstwerke, sogar eine uralte Bibelhandschrift –, die von den alten reichen Familien und von Gegnern der Junta geraubt wurden.
Sie seien natürlich kein Auktionshaus, sagt De Wiel ungerührt, doch er könne mit entsprechenden Konten und auch mit einem Transport außer Landes behilflich sein, wenn die Bank eine höhere Provision kassieren könne. Der Deal ist perfekt, und auf der Rückfahrt breitet sich ein triumphierendes Lächeln auf Yvans Gesicht aus, die erste emotionale Regung seit seiner Ankunft in Buenos Aires.
In manchen Rezensionen wird ein Vergleich zu Joseph Conrads Novelle „Herz der Finsternis“ über den britischen Kolonialismus und den brutalen General Kurtz gezogen, der die Eingeborenen in Afrika zur Ablieferung von großen Mengen Elfenbein zwingt. Man fühlt sich noch unmittelbarer an die Rolle der Schweizer Banken während der Nazi-Zeit erinnert, die das geraubte Gold von jüdischen Familien und ermordeten KZ-Häftlingen auf entsprechenden Konten angelegt hatten.
Vordergründig dreht sich „Azor“ um die Rolle der Schweizer Banken zur Zeit der argentinischen Diktatur Anfang der 80er Jahre. Doch dies ist nur die konkrete Vorlage für eine allgemeine, weltweite Entwicklung des Finanzkapitals in der Gegenwart.
In Argentinien habe es während der Diktatur „nicht nur zwei oder drei Banker“ gegeben, die „das Potenzial für eine Superchance witterten“, sagt der Regisseur. Als die Militärs an die Macht kamen, frohlockte die Finanzwelt: „Unsere Freunde sind an der Macht, packen wir es an!“ Er habe mit Erschrecken festgestellt, „dass es für Banker keine Gewissenskonflikte gibt, sondern nur Interessenkonflikte“. Moral sei nur eine betriebswirtschaftliche Größe.
Auch der Unterschied zwischen Privatbanken und sogenannten seriösen Geschäftsbanken verschwimmt. Im Film tritt einer der Hauptkunden des Privatbankiers De Wiel namens Farrell auf, der nach dem Verschwinden von Keys abwägt, ob er nicht lieber mit Credit Suisse zusammenarbeiten möchte. Er wird mit den Worten zitiert: „Commercial und Private Banking, das ist wie der Vergleich zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem Privatjet.“ Inés De Wiel bemerkt darauf zu ihrem Mann, insgesamt müsse bei den Banken eine neuere Generation das Sagen haben, „die aggressiver vorgeht“.
Fontana verweist auf die Unterstützung Schweizer Banken auch für andere diktatorische Regime, wie das von Alfredo Stroessner in Paraguay, Ferdinand Marcos auf den Philippinen, Mobutu im Kongo oder für die Franco-Diktatur in Spanien, deren Folterknechte Schweizer Bankkonten hatten. Auch nennt er den Skandal um die größte europäische Bank HSBC.
Man könnte hinzufügen, dass seit den 80er Jahren das Finanzkapital eine immer größere Rolle bei Kriegen, Umsturzversuchen und Geldwäsche für terroristische und kriminelle Organisationen gespielt hat. Für das ukrainische Regime in Kiew, das 2014 durch einen rechtsextremen Putsch an die Macht gekommen ist, stellten die großen amerikanischen und europäischen Banken über 20 Milliarden Dollar zur Verfügung. Der Hauptfinanzier des Firmenimperiums von Donald Trump, der am 6. Januar einen Putschversuch von Rechtsextremen in Washington angezettelt hat, ist die Deutsche Bank.
Auf die Frage, ob sein Film nicht „heftige Reaktionen in der Schweiz hervorrufen könnte“, antwortet der in Genf geborene Andreas Fontana, der einige Zeit in Argentinien gelebt hat und dessen Großvater selbst Bankier war, selbstbewusst und entschieden: „Um die Wahrheit zu sagen, das Provozieren von Reaktionen ist das, was mich interessiert. Die Schweizer Banken haben sich nie zu ihrer Rolle bekannt oder ein Mea Culpa geäußert. Ich habe den Eindruck, dass es an uns, meiner Generation, liegt, die Verantwortung für die dunkelsten Stunden des 20. Jahrhunderts zu schultern. Nicht dass ich mich schuldig fühle, aber ich finde es absolut notwendig, das Nachdenken über das Thema zu fördern.“
„Die Saat“
Der zweite Spielfilm von Mia Maariel Meyer nach ihrem vielbeachteten Sozialdrama „Treppe aufwärts“ (2015) lässt den Klassenkampf auf die Leinwand zurückkehren. Sie thematisiert den gnadenlosen Druck der Banken auf einen Bauarbeiter, der entlassen wird, nachdem er auf seiner Baustelle gegen die Superausbeutung gekämpft hat.
In Zentrum steht die Familie von Rainer (Hanno Koffler), seiner schwangeren Frau, die Krankenschwester ist, und seiner 13-jährigen Tochter Doreen. Der Film hat zwei parallele Handlungsstränge: Die heftige Auseinandersetzung, die Rainer auf der Baustelle des mittelständischen Familienunternehmens vor den Toren Berlins erlebt, für das er seit zwanzig Jahren als Fliesenleger gearbeitet hat. Und der ebenfalls heftige Konflikt seiner Tochter mit der Nachbarstochter im brandenburgischen Umland, in das die Familie aufgrund steigender Mieten gezogen ist.
Bei der Errichtung von Luxusapartments soll Rainer als Bauleiter arbeiten. Der Seniorchef, mit dessen Familie Rainer per Du ist, hat ihm diesen Posten versprochen. Doch der Juniorchef Max, der die Firma übernimmt, degradiert ihn und ersetzt ihn durch Jürgen, der als Schinder bekannt ist. Dieser hat ausschließlich die Interessen der Investoren im Blick und richtet das Bauprojekt skrupellos auf Profit aus.
Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Rainer hat das Gehalt des Bauleiter-Posten einberechnet, um den Kredit für das renovierungsbedürftige Häuschen im Umland zu bezahlen. Schließlich flattern nur noch Mahnungen für unbezahlte Rechnungen und zuletzt die Sperrung des Bankkontos herein. Rainer übernimmt einen Zweitjob als Autowäscher am Abend. Seine hochschwangere Frau lässt sich für zusätzliche Schichten im Krankenhaus einteilen und riskiert fast den Tod des ungeborenen Kinds.
Auf der Baustelle organisiert der neue Vorgesetzte Jürgen inzwischen extreme Arbeitshetze, und Rainer wird zum Anführer eines aufkeimenden Widerstands, bis hin zum spontanen Streik gegen die Entlassung eines Kollegen. Darauf lässt der Bauleiter in Absprache mit dem Juniorchef einen ganzen Bus mit Leiharbeitern vorfahren. Die Drohung, alle zu entlassen, lässt den Streik zusammenbrechen.
Rainer, der als einziger nicht nachgibt, wird entlassen. Daraufhin bricht sich seine Wut Bahn, er schlägt den Bauleiter nieder und demoliert dessen Auto – in dem allerdings das Kind des Bauleiters sitzt, was Rainer nicht wissen konnte. Zum Schluss fließen einige Tränen über sein verzweifeltes Gesicht.
Parallel wird auch für seine Tochter Doreen das Leben zum Drama. Sie lernt das Nachbarmädchen Mara kennen, dessen reicher, arroganter Vater mit Herablassung auf ihre Arbeitereltern blickt. Die neue Freundschaft wird bald zur Qual. Mara, die affektiert und selbstherrlich auftritt, stachelt Doreen zu bösen Streichen an und verwickelt sie in einen Diebstahl.
Schließlich greift Mara Doreen tätlich an, weil sie ihre Anstiftung zum Stehlen verraten habe. Sie verfolgt Doreen mit dem Fahrrad, wirft sie brutal samt Fahrrad zu Boden. Doch Doreen wehrt sich, wie ihr Vater, und sie bleibt dieses Mal Sieger. Mara rollt den Hang hinunter. Am Ende hilft ihr Doreen wieder hoch.
Die Regisseurin Mia Maariel Meyer zeigt in ihrem Film sehr anschaulich, wie der heutige Kapitalismus die Gegensätze zwischen den Klassen zuspitzt und schließlich zu explosiven und gewaltsamen Zusammenstößen führt. Die „Saat der Gewalt“ ist das kapitalistische Profitsystem. Der Druck, den die herrschende Klasse in allen Betrieben verschärft, um die Geldgeber und Aktionäre an der Börse zu befriedigen, wird den Widerstand der Arbeiter und den Klassenkampf anfeuern.
Ein Klassenkompromiss oder sozialer Ausgleich, wie er vor allem in Deutschland nach dem letzten Weltkrieg mithilfe von Gewerkschaften organisiert wurde, ist in der heutigen Krise nicht mehr möglich. Die Gewerkschaften stehen inzwischen auf der anderen Seite der Barrikade und helfen den Unternehmensvorständen, Entlassungen und Arbeitshetze durchzusetzen.
Daher entspricht der versöhnliche Schluss, bei dem Doreen der verwöhnten Mara die Hand reicht und ihr Vater über seinen „Gewaltausbruch“ Tränen vergießt, eher dem Wunschdenken der Regisseurin als der Realität.