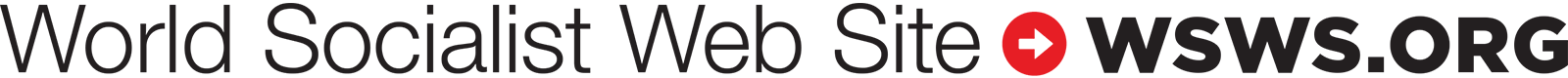Die Stellungnahmen der Finanzbehörden und Großbanken zur Eindämmung der aktuellen Finanzkrise sind in sich widersprüchlich und nehmen einen immer skurrileren Charakter an.
So werden einerseits Sofortmaßnahmen angekündigt und die zunehmenden Risiken beschworen, andererseits wird versichert, alles sei in bester Ordnung.
Die Australian Financial Review kommentierte Anfang der Woche lakonisch: „Es ist eine der großen ungeschriebenen Regeln des Lebens: Wenn Ihnen jemand sagt, alles ist in Ordnung und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, können Sie davon ausgehen, dass das Gegenteil der Fall ist.“
Eigentlich garantiert die Einlagensicherungsgesellschaft der USA (FDIC) nur Einlagen bis zur Höhe von 250.000 Dollar. Doch im Falle der Silicon Valley Bank und der Signature Bank beschlossen die FDIC und die amerikanische Notenbank (Fed) mit Unterstützung der Biden-Regierung, auch für höhere Einlagen einzustehen, und begründeten dies mit einem „systemischen Risiko“.
Kurz darauf gewährten die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) der Credit Suisse zusätzliche Kredite und betonten dabei, von der Krise im US-Bankensystem gehe keinerlei Ansteckungsgefahr aus. Die Credit Suisse nahm das Angebot in Höhe von 54 Milliarden Dollar von der SNB dankend an.
Unterdessen hatten sich die größten US-Banken am 16. März zu einer umfangreichen Intervention entschlossen und der First Republic Bank insgesamt 30 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt – der Bank, die im Kielwasser des SVB-Zusammenbruchs unter beträchtlichen finanziellen Zugzwang geraten war.
Aufgrund der gravierenden Folgen des SVB-Kollapses für den Finanzsektor wurde eine Notoperation ins Leben gerufen, an der sich insgesamt elf Banken beteiligten. Angeführt wird sie von JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, die jeweils 5 Milliarden Dollar einzahlen. Andere, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, steuern kleinere Beträge bei.
Auch diese Aktion stand in schreiendem Widerspruch zu den beruhigenden Worten, mit denen sie begleitet wurde.
In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten die Banken mit, dass ihre Maßnahme ihr „Vertrauen in das nationale Bankensystem“ widerspiegele. Sie würden ihre „Finanzkraft und Liquidität im Rahmen des Systems dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt wird“.
Wenn die Banken so zuversichtlich sind, weshalb sind diese Maßnahmen überhaupt erforderlich?
Die Rettungsinitiative – initiiert vom CEO der JPMorgan Bank, Jamie Dimon, und anderen Bankmanagern, die sonst eher nicht Milliarden ohne Aussicht auf Rendite verpulvern – lässt darauf schließen, dass sie um die Stabilität des gesamten Finanzsystems fürchten.
Während der Krise von 2008 sorgte Dimon dafür, dass JPMorgan die Investmentbank Bear Stearns übernahm und Teile der Washington Mutual aufkaufte. Danach beteuerte er, dass er sich nie wieder an einer staatlich geführten Rettungsaktion beteiligen werde. Doch genau das tat er jetzt bei der Rettungsaktion für die First Republic Bank.
Diese Aktion ist zwar etwas anders beschaffen als die Übernahmen von 2008, wurde jedoch auch in enger Abstimmung mit Finanzministerin Janet Yellen, dem Finanzministerium und den Finanzaufsichtsbehörden eingefädelt.
Finanzministerin Yellen, der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell und die Finanzaufsichtsbehörden veröffentlichten eine gemeinsame Pressemitteilung, in der sie die Unterstützung durch die Großbanken begrüßten und betonten, dass sie die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems unter Beweis stelle.
In Wirklichkeit beweist die Rettungsaktion das Gegenteil: Die Krise, die nach dem SVB-Kollaps ausgelöst wurde, metastasiert weiter, und es wird befürchtet, dass sie als nächstes die First Republic Bank befällt.
Die First Republic sieht sich veranlasst zu betonen, dass sie finanziell absolut stabil sei – sie kann sich auch kaum leisten, etwas anderes zu behaupten – und dass ihre Verluste gering seien.
Diese rosige Einschätzung wird jedoch von den Finanzmärkten nicht geteilt. Die Ratingagentur S&P Global stufte am Mittwoch die Anleihen der First Republic gnadenlos auf Ramschstatus herab, und auch der Kurs ihrer Aktien fiel im Verlauf der Woche um rund 60 Prozent. Seit Beginn der SVB-Krise am 8. März ist die Marktkapitalisierung der First Republic von 21 Milliarden Dollar auf rund 5 Milliarden Dollar gesunken.
Das Wall Street Journal berichtete, dass die Bank lange den Ruf eines Überfliegers hatte und dass ihre „Geschäfts- und Börsenbewertung lange Zeit den Neid der ganzen Bankenbranche auf sich zog“. Zu ihren Kunden zählten vor allem wohlhabende Privatpersonen und Unternehmen, und im Kreditgeschäft vergab sie „gewaltige Hypotheken“ an Kunden wie den Facebook-Chef Mark Zuckerberg.
Die Lage der bislang gescheiterten und ins Schlingern geratenen Banken unterscheidet sich natürlich im Einzelnen. Dennoch gibt es eine übergreifende Gemeinsamkeit. Der Wert der Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapiere, die sie zu Zeiten der quantitativen Lockerung und der entspannten Geldpolitik der Fed erworben haben, ist aufgrund der Zinserhöhungen des vergangenen Jahres eingebrochen. Der Marktwert dieser Positionen ist nun also weitaus niedriger als der Wert, zu dem sie in den Bilanzen der Banken verbucht wurden.
Diese Divergenz zwischen Marktwert und Buchwert ist kein Problem, solange weiterhin Geld in die Kassen der Banken fließt. Sobald jedoch Barmittel abgezogen und die wertgeminderten Finanzanlagen veräußert werden müssen, werden die Verluste realisiert.
Kommt es dann zu einem Ansturm auf die Bank, wie im Fall der SVB und der Signature, droht der Bank die Insolvenz.
Das Vorgehen der FDIC, bei der SVB und Signature auch Einlagen oberhalb von 250.000 Dollar zu garantieren, hat den Unmut der Finanzaufsichtsbehörden in anderen Ländern, vor allem in Europa, auf sich gezogen.
Anfang dieser Woche berichtete die Financial Times, die europäischen Finanzaufsichtsbehörden seien „wütend“ über die Spezialbehandlung für die SVB und würden sich darüber beschweren, dass die US-Behörden gegen das Regelwerk verstießen, das sie selbst mit verfasst haben.
„Ein hoher Beamter der Eurozone äußerte sich schockiert über die ‚absolute Inkompetenz‘ der US-Behörden, insbesondere, nachdem diese über 15 Jahre lang auf ‚langen und ermüdenden Sitzungen‘ das Ende von Rettungsaktionen gepredigt hätten“, berichtet die FT.
Ein weiterer europäischer Regulierungsbeamter wird von der FT mit den Worten zitiert, dass bei der Rettungsaktion für die SVB letztendlich einfache Bürger dafür aufkommen müssten, dass schwerreiche Risikokapitalgeber geschützt werden, und dies sei „grundfalsch“. Als Beispiel wird Peter Thiel angeführt, ein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, der zum Zeitpunkt des Konkurses 50 Millionen Dollar bei der SVB deponiert hatte.
Ein ehemaliger Beamter des US-Finanzministeriums gab zu bedenken, dass der Fall der SVB den Verdacht befeuere, „dass sich die USA in schwierigen Zeiten nicht an die weltweit vereinbarten Regelungen halten“.
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss unterdessen auf seiner geldpolitischen Sitzung am Donnerstag, trotz der Finanzturbulenzen der Vorwoche die Leitzinsen um 50 Basispunkte heraufzusetzen.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde teilte mit, einige Ratsmitglieder hätten die Zinserhöhungen aussetzen wollen, um zunächst die Entwicklung der Lage besser beurteilen zu können, aber die große Mehrheit sei für die Anhebung gewesen, um das Vertrauen in das Euro-Bankensystem zu stärken.
Allerdings strich der EZB-Rat aus seinen geldpolitischen Beschlüssen die bisherige Ankündigung, dass er weiterhin „die Zinsen deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo anhebt“, und deutete damit an, dass er die Zinserhöhungen in Zukunft aussetzen könnte.
Bei der nächsten Sitzung des geldpolitischen Gremiums der US-Notenbank wird die Frage, wohin die geldpolitische Reise geht, noch entschiedener gestellt. Dann muss die Fed entscheiden, inwieweit die Zinserhöhungen angesichts der finanziellen Verwerfungen, die sie verursachen und sogar noch verschärfen, fortgesetzt werden sollen.
Die Fed begann vor einem Jahr mit Zinserhöhungen, als sich abzeichnete, dass die Inflation nicht „vorübergehend“ war, sondern die Lohnkämpfe der Arbeiter antrieb. Das eigentliche Ziel der Geldverknappung durch höhere Zinsen bestand nicht in der „Inflationsbekämpfung“, sondern darin, die Konjunktur zu bremsen, die Arbeitslosigkeit in die Höhe zu treiben und die Arbeiter damit in Schach zu halten.
Die Fed war sich durchaus bewusst, dass Zinserhöhungen zu Problemen auf den Finanzmärkten führen könnten. Die größte Gefahr für das finanzielle Kartenhaus sieht sie jedoch in einer wiedererstarkten Arbeiterklasse.
Seither ist die Lage für die Fed und alle anderen staatlichen Institutionen, mit denen die Interessen der Finanzoligarchie verteidigt werden, deutlich schwieriger geworden.
Die wachsende Bewegung der Arbeiterklasse stellt die größte Gefahr für die Macht des Finanzkapitals dar. Aus Sicht der Zentralbanken müssen die Zinssätze daher weiter erhöht werden, doch damit verschärfen sie zugleich die Finanzkrise.