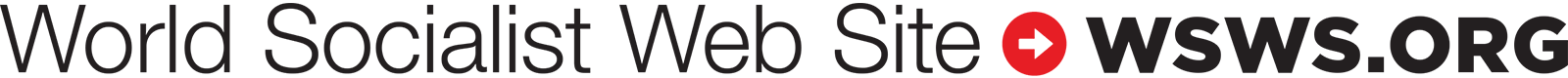Die gegenwärtige deutsche ausländerfeindliche Politik ist das Produkt einer längeren Entwicklung. Die drei Dokumentarfilme der Berlinale-Filmreihe „Fiktionsbescheinigung“ geben einen Einblick in die 70er und 80er Jahre. Die Erfahrungen, die Migranten sowohl in der BRD als auch in der sich sozialistisch bezeichnenden DDR machten, waren ernüchternd.
Stellvertretend für die erste Gastarbeitergeneration der BRD erzählt Yüksel Yavuz im mehrfach ausgezeichneten Film Mein Vater der Gastarbeiter (1995) die Geschichte seines Vaters.
Wie viele junge Leute, die vor der Perspektivlosigkeit auf dem Land in die Städte strömten, kam Cemal Yavuz 1968 nach Deutschland. Auswahlkommissionen suchten gezielt nach Arbeitern für die Industrie.
Aus dem geplanten Arbeitsjahr werden 16 Jahre. Cemal arbeitet auf der Sietas-Werft in Hamburg, getrennt von den Kindern und seiner Frau, die sich um die kleine Schaf-Wirtschaft kümmert. Nur im Sommer kann er die Familie besuchen und wird ihr immer fremder. Er nimmt seinen Sohn Yüksel mit nach Deutschland. Dann hält er die Trennung nicht mehr aus und kehrt 1984 mit der Rückkehrprämie der Kohl-Regierung zurück.
Jahre später will er seinem Sohn, der in Hamburg blieb, den alten Arbeitsplatz zeigen. Er ist stolz darauf moderne Schiffe mitgebaut zu haben, sieht den neuen Kran, lobt die Umsichtigkeit des neuen Besitzers (des Sohns des alten), zur Umsatzsteigerung in Technik zu investieren. Der ehemalige Musterarbeiter ist schockiert und verbittert als ihm der Zutritt verweigert wird.
Heute wird immer noch gern über die „kulturelle Zerrissenheit“ von Migranten geredet. Es sind Scheindiskussionen. Konkret zerrissen werden, wie der Film zeigt, Familien durch Armut, ausländerfeindliche Gesetze, Krieg. Der ländlich-rückschrittliche „Kulturkreis“ kurdischer Bauern zeigt sich im Film als politisch produzierte Armut.
Die Bauern sind verbittert, dass der türkische Staat alles verkommen lässt. Modern seien nur die Panzer, die man nach Norden fahren sieht gegen kurdische Nationalisten. In diese Trostlosigkeit kehrt der Vater zurück. Während er resigniert feststellt, dass die Qualität seiner Bäume schlechter geworden ist, hat er den kraftvollen Metallklang der Hamburger Werft im Ohr.
Der Film zeigt, wie türkische Arbeiter bewusst isoliert wurden. Auch der Vater lebte in der „Klein Istanbul“ genannten Barackensiedlung nahe der Werft. Der Besitzer spielte ausländische gegen einheimische Arbeiter aus. Zehn Stunden, so der Vater, dauerte die Schicht der türkischen Arbeiter, die der deutschen acht, was zu Spannungen in der Belegschaft führte. Sein Vater, so der Regisseur nach der Filmvorführung, wollte nie wieder nach Deutschland.
Isoliert leben auch afrikanische Studenten im Dokumentarfilm Man Sa Yay / I, Your Mother (1980), den die international bekannte senegalesische Regisseurin Safi Faye damals für das Westdeutsche Fernsehen drehte. Moussa ist Student an der Westberliner Technischen Universität. Wie andere, die hier Elektrotechnik oder Maschinenbau studieren, hält er sich mit Gelegenheitsjobs und dem Verkauf afrikanischer Holzschnitzereien über Wasser. Bei Regen verdienen die „Holzverkäufer“ nichts.
Moussa hat viel Mühe, die Wünsche der Verwandten zu erfüllen, die ihn scheinbar für wohlhabend halten, da er ja in Europa lebt: modische Kleidung, Fernseher usw. Er fühlt sich alleingelassen. Auch viele Deutsche fragten ihn nur, woher er komme und wie lange er bleibe. Dabei, erklärt er, seien die heutigen kulturellen und ökonomischen Probleme international verbunden. Er sehnt sich nach seiner Lebensgefährtin im Senegal, die ihm poetische Briefe schreibt.
Ergänzt sei an der Stelle: Die 70er Jahre waren das „sozialdemokratische Jahrzehnt“ mit den SPD-Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. West-Berlin wurde schon seit 1955, Hamburg (mit einer Ausnahme) sogar seit 1946 von SPD-Bürgermeistern regiert. Wie nationalistisch offizielle „linke“ Politik schon damals war, zeigen anschaulich die eng mit der SPD verflochtenen Gewerkschaften. Sie betrachteten die Anwerbeabkommen mit der Türkei und anderen Ländern als Bedrohung für deutsche Arbeiter, traten für Beschränkungen ein und hetzten gegen „illegale Einwanderer“.
Ein indischer DDR Vorwende-Film
Dass in der stalinistischen DDR junge Menschen studierten, die nicht nur aus den Ostblockstaaten kamen, hatte nichts mit dem offiziell propagierten Internationalismus zu tun, der in der Praxis an der Berliner Mauer aufhörte. In Konkurrenz zum Westen ging es um die Ausweitung des politischen Einflusses auf sogenannte „junge Nationalstaaten“, in denen nationale Befreiungsbewegungen an die Macht gekommen waren. Wer in die DDR kam und Sozialismus erwartete, wurde enttäuscht.
Chetna Vora (1958 – 1987) Tochter indischer Kommunisten, absolvierte 1976 – 1982 ein Filmstudium in Potsdam-Babelsberg. 1980 entsteht ihr Diplomfilm Oyoyo. Der etwa 45-minütigeDokumentarfilm stellt internationale Studenten ins Zentrum, die in einem Ostberliner Wohnheim leben. Ein junger Immigrant kommt aus der Diktatur in Chile, Carmen aus dem seit 1974 unabhängigen Guinea-Bissau, andere aus „Bruderländern“ wie Kuba, der Mongolischen Volksrepublik oder Bulgarien. Man verständigt sich auf Deutsch.
In den Interviews mit Chetna, sprechen sie über Alltag, Liebe. Im Zentrum des Films steht weniger der Inhalt der Gespräche, sondern ihre Haltung, zwanglos, freimütig und emotional. Etwa bei der Studentin, die sich in einen kubanischen Kommilitonen verliebt hat. Das mag etwas banal scheinen. Aber in der stalinistischen DDR haftete Migranten immer etwas Offizielles an. Die Tatsache, dass sie unter staatlicher Kontrolle standen, brachte sie auch in eine gewisse Distanz zur Bevölkerung.
Im Wohnheim sind sie keine lebenden Aushängeschilder staatlicher Solidarität mehr sondern normale Menschen. Als Carmen irgendwann sagt, dass es ihr in der DDR gefällt und in den offiziellen Dankbarkeitston verfällt, wird sie von Chetna unterbrochen. Irgendwann singen sie alle „Oyoyo“, ein Song, in dem es offenbar darum geht, nicht zu allem „Yes Sir“ zu sagen.
Mit ihrem ersten Langfilm Frauen in Berlin (1982) überschreitet Chetna für die SED eine rote Linie. Sie verlässt das Migranten-Milieu und begibt sich direkt ins Ostberliner Leben. DDR-Frauen sprechen ungeschminkt über Alltag, Familie, Beziehungen. Sie vertrauen sich einer ausländischen Studentin an und offenbaren laut Filmmuseum Potsdam auch ihre Skepsis gegenüber der „Zukunft des Arbeiter- und Bauernstaats“. Der Film wurde sofort eingezogen.
1983, ein Jahr bevor der kurdische Arbeiter Cemal Yavuz enttäuscht die BRD verlässt, verließ Chetna Vora die DDR mit der kleinen Tochter und ihrem deutschen Mann Lars Barthel (er führte bei Oyoyo die Kamera) Richtung Indien. Später leben sie in Westberlin. Chetna Vora stirbt 1987 in Indien.