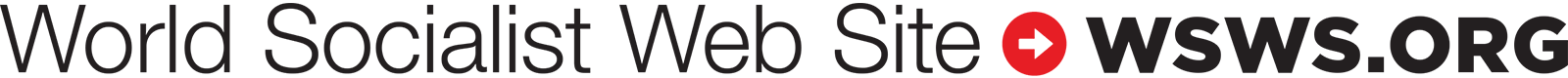Die tiefe Krise der Credit Suisse drohte das europäische und globale Finanzgebäude zum Einsturz zu bringen. In einer Notfallmaßnahme organisierten daher der Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Bankenübernahme durch die UBS.
Die extreme Schieflage der Credit Suisse zwang die Schweizer Regierung, die Vorschrift außer Kraft zu setzen, nach der Aktionäre über jede Übernahme abstimmen müssen. Auch die Veröffentlichung des Beschlusses noch am Sonntagabend erfolgte extra so zeitnah, um dem erwarteten Abwärtsdruck durch die asiatischen Finanzmärkte den Schwung zu nehmen.
Die Entscheidung zur Übernahme folgte dem gescheiterten Versuch der SNB, die Geldabflüsse der Bank einzudämmen, die Experten auf mindestens 10 Milliarden Dollar pro Tag schätzten. Allein zu diesem Zweck hatte die Schweizer Zentralbank der Bank 54 Milliarden Dollar an Krediten zur Verfügung gestellt, die im Verlauf der Woche sogar auf astronomische 100 Milliarden Dollar erhöht werden mussten.
Folglich bot die UBS mit ihrer 3,25 Milliarden Dollar teuren Übernahme den einzig gangbaren Weg aus der Misere. Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset sagte dazu: „Am Freitag wurde deutlich, dass konventionelle Lösungen nicht mehr geeignet waren, die Kapitalabflüsse und die hohe Marktvolatilität zu beenden und verlorenes Marktvertrauen wiederherzustellen. Es war daher absolut unerlässlich, dass wir eine rasche und stabilisierende Lösung finden.“
Der Bundespräsident erklärte: „Ein unkontrollierter Absturz der Credit Suisse hätte unkalkulierbare Folgen für das Land und die internationale Finanzwelt. Wir müssen alles tun, um eine weitreichende Finanzkrise zu vermeiden.“
Um der UBS den Deal schmackhaft zu machen, verpflichtete sich die Schweizer Regierung, mehr als 9 Milliarden Dollar bereitzustellen, um einen Teil der Übernahme-Verluste zu decken. Zudem wird die SNB 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, um die Integration der beiden Großbanken zu erleichtern.
Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter stellte die Realität kurzerhand auf den Kopf, als sie in ihrer Pressekonferenz erklärte, es handele sich hier nicht um ein Rettungspaket und auch um „keine Staatslösung“.
Keller-Sutter weiter: „Ein Bankrott der Credit Suisse hätte einen riesigen Kollateralschaden auf dem Schweizer Finanzmarkt verursacht, sowie eine Ansteckungsgefahr für die UBS und andere Banken, auch international.“ Sie betonte, dass auch die USA und das Vereinigte Königreich diese Lösung begrüßt hätten, da auch sie sich um die Credit Suisse „ernsthafte Sorgen“ gemacht hätten.
In dasselbe Horn stieß auch die FINMA, als sie erklärte, dass die Credit Suisse eine „Vertrauenskrise“ durchgemacht habe. Zudem habe das Risiko bestanden, „dass die Bank zahlungsunfähig wird, selbst wenn sie auf dem Papier weiterhin solvent ist. Deshalb mussten die Behörden Sofortmaßnahmen ergreifen, um schwerwiegende Schäden von den Schweizer und internationalen Finanzmärkten abzuwenden.“
Seit der Bankenkrise im Jahre 2008 stellt der Zwangsverkauf der Credit Suisse den gravierendsten Eingriff ins Bankensystem dar. Und dennoch ist es alles andere als klar, ob damit weitere Nachbeben und Turbulenzen ausgeschlossen sind. Wie die Financial Times in einem Kommentar feststellte, „kann man nicht wissen, ob dadurch der Ansturm auf die europäischen Banken aufgehalten werden kann. Denn Beschwichtigungsversuche sind wie ein zweischneidiges Schwert und gerade während einer Finanzpanik höchst riskant. Sie können die Ängste der Anleger ebenso leicht verstärken wie zerstreuen.“
Zwar war die Credit Suisse durch die zweistelligen Milliardenverluste infolge des Zusammenbruchs von Archegos Capital und Greensill sowie durch ihre geringe lnvestment-Rentabilität schon angeschlagen. Aber dies war nicht der Auslöser für ihren Niedergang.
Der Kollaps der Credit Suisse ist vielmehr Ausdruck der enormen Veränderungen in der Finanzwelt, die sich im Laufe des letzten Jahres vollzogen haben. Die Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank, erhöhten ihre Zinssätze rigoros, nachdem sie 15 Jahre lang im Rahmen „quantitativer Lockerungen“ praktisch unbegrenzt Geld zur Verfügung gestellt hatten.
Diese finanzpolitische Umorientierung führte zum Kollaps der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB). Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, zu Deutsch: Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft) beschlagnahmte am 10. März die SVB, nachdem ein 40 Milliarden Dollar Bankenansturm die Bank in ihren Grundfesten erbeben ließ.
Erst daraufhin geriet die Credit Suisse so stark unter Druck, dass die mit 10 Prozent der Aktien beteiligte saudische Nationalbank ankündigte, kein weiteres Kapital mehr in Aussicht zu stellen. Die Schweizerische Nationalbank bot daraufhin einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar an, doch hat dies die Krise eher noch vertieft als entschärft, worauf es zu den Krisensitzungen am Wochenende kam.
Über Jahrzehnte hindurch war die Credit Suisse eine weltweit angesehene Großbank, die in Europa, Asien und den USA geschäftlich operierte. Noch zum Jahresende 2022 wies sie eine Bilanzsumme von einer halben Billion Dollar auf. Sie beschäftigte 50.000 Mitarbeiter, die jetzt nach der USB-Übernahme zu Tausenden ihren Arbeitsplatz räumen müssen.
Es steht zu befürchten, dass die Übernahme sowie die ursprüngliche Krise selbst auch auf andere Bereiche des Finanzsystems übergreifen wird. Daher kündigten, parallel zur Entscheidung der Credit Suisse, die Fed und fünf weitere große Zentralbanken Maßnahmen an, um den Dollarfluss in das globale Finanzsystem zu erhöhen, um somit wieder adäquate Liquiditätsabdeckungen zu erzielen.
Die Financial Times berichtete, dass eine der Hauptsorgen der europäischen Behörden die „massiven Verluste der Aktionäre und Anleiheinhaber der Credit Suisse“ seien. Diejenigen, die nun die Schulden der Bank tragen, könnten „den Konflikt auf dem Bankfinanzierungsmarkt in dieser Woche noch verschärfen“.
In einer gemeinsamen Pressemitteilung kündigten die Zentralbanken an, dass sie ab sofort tägliche statt wöchentliche Dollar-Auktionen abhalten werden, um damit „die Anspannung auf den globalen Refinanzierungsmärkten zu lindern“.
Jenseits des Atlantiks deutete nichts auf eine Entspannung der Krise hin, die seit dem SVB-Kollaps grassiert. Im Gegenteil, sie spitzt sich weiter zu! Seit der Wiederöffnung der Märkte am Montag gilt das Interesse der gesamten Finanzwelt der First Republic Bank. Es ist die Bank, die als eine der ersten vom Zusammenbruch der SVB „kontaminiert“ wurde.
Letzte Woche beschlossen elf Großbanken, angeführt von JPMorgan Chase und ihrem CEO Jamie Dimon, in Zusammenarbeit mit der US-Finanzministerin Janet Yellen, 30 Milliarden Dollar bei der First Republic Bank zu hinterlegen. Damit wollen sie die Befürchtung zerstreuen, dass die Bank ähnliche Probleme wie die SVB haben könnte, die Kontoabbuchungen der Kunden zu realisieren.
Doch zumindest bis jetzt scheint dieser Plan nicht zu fruchten. Ungeachtet der 30 Milliarden Dollar Zufluss sind die Aktien der Bank am Freitag um mehr als 30 Prozent eingebrochen, was den Gesamtverlust seit dem SVB-Kollaps auf mehr als 70 Prozent erhöht.
Denn das gleiche ursächliche Problem der SVB hat auch die First Republic. Es besteht darin, dass der Marktwert ihrer US-Staatsanleihen und anderen Finanzanlagen, die sie gekauft hatte, als das Zinsniveau nahezu bei Null lag, jetzt aufgrund der Zinserhöhungen niedriger ist als ihr Buchwert. Anders ausgedrückt, die Bank erleidet jedes Mal empfindliche Verluste, wenn sie eine dieser Anlagen verkauft, um beispielsweise Kontoabbuchungen der Kunden durchführen zu können.
Die Finanzexperten beurteilen daher zu Recht die Lage der First Republic weiterhin als negativ. Julian Wellesley, globaler Analyst bei Loomis Sayles, sagte gegenüber dem Wall Street Journal: „Es bleibt offen, ob das Unternehmen überhaupt eigenständig weitergeführt werden kann.“
Die Analysten des Finanzunternehmens KBW, das die Banken-Performance überwacht, bezeichneten die Veränderungen in der Bilanz von First Republic in der vergangenen Woche als „erschütternd“. Die Entscheidung, die Gewinnausschüttung für Stammaktien auszusetzen, zeichne einen „sehr düsteren Ausblick“ für das weitere Bestehen des Unternehmens und dessen Aktionäre.
Die Analysten des Finanzinstituts Wedbush warnten am Freitag, dass im Falle eines Verkaufs der Bank aufgrund des Wertverlusts bei Krediten und Wertpapieren nur ein „minimaler oder gar kein“ Restwert übrigbleiben werde.
Die SVB-Krise, die sich im gesamten Bankensystem bemerkbar macht, führte zu der Forderung, dass die Höhe staatlich versicherten Einlagen über die heutigen 250.000 Dollar anzuheben sei. Diese Änderung, von der Superreiche am meisten profitieren, wird von wachsenden Teilen des politischen Establishments und den Bank-Lobbyisten getragen.
Selbst die pseudo-linke Demokratin Elizabeth Warren, die sich so gerne als Gegnerin der Ultra-Vermögenden inszeniert, hält die Aufhebung der Obergrenze für einen „guten Schritt“. Als sie im Verlauf des CBS-Interviews gefragt wurde, wo denn die neue Grenze liegen solle, witzelte sie: „Sind das 2 Millionen Dollar? Sind das 5 Millionen Dollar? Sind das 10 Millionen Dollar?“
Diese Maßnahme nützt nur extrem wohlhabenden Anlegern (etwa dem Risikokapitalgeber Peter Thiel, der bei der SVB 5 Millionen Dollar verloren hätte, wäre nicht zuvor die Entscheidung gefallen, dass auch die nicht versicherten Einleger vollständig ausbezahlt werden), Warren versucht, die Maßnahme als Unterstützung für kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zu tarnen. Angeblich soll sie dazu dienen, dass diese ihre Löhne und Versorgungsrechnungen bezahlen können.
Ein weiterer, bisher wenig beachteter, Aspekt der Finanzkrise ist die Situation auf dem 22 Billionen Dollar umfassenden US-Staatsanleihenmarkt. Obgleich dieser Markt das Fundament des globalen Finanzsystems darstellt, ist er gefährdet.
Am Wochenende stand in einem Artikel der Financial Times, dass der Markt für US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche die heftigsten Schwankungen seit der Krise von 2008 erlebt habe. Die täglichen Handelsmengen seien um mehr als das Doppelte angestiegen, „als die SVB-Insolvenz eine regelrechte Massenflucht hin zu den sicheren Staatsanleihen bewirkte“. Nach Meinung der Experten hat der Markt im Wesentlichen reibungslos gearbeitet. Doch das kann sich jederzeit ändern.
In dem Text wurde Priya Misra zitiert, die Abteilungsleiterin des Global Rates Research bei der TD Securities. Sie sagte: „Eine, einzige Krise trennt uns noch von einem kompletten Liquiditätsverlust und damit einhergehend dem endgültigen Zusammenbruch des Staatsanleihenmarkts.“